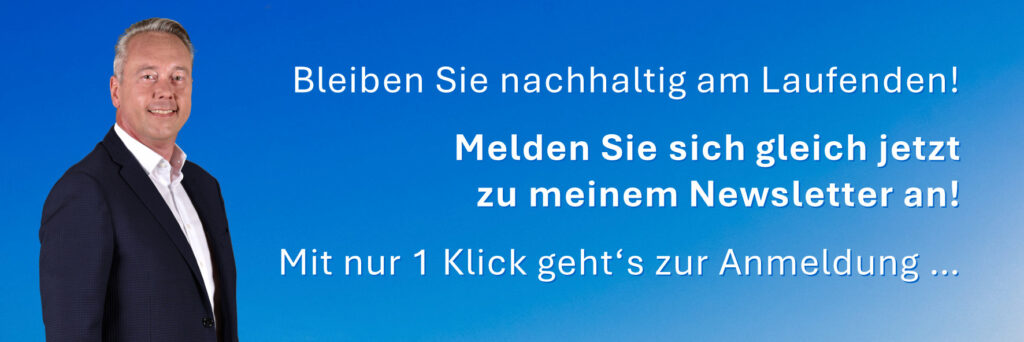Viele grüne Visionen zerplatzen wie eine Seifenblase
Klimaneutralität bis zum Jahr 2050, so lautet das visionäre Ziel des europäischen Grünen Deals, das EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen im Dezember 2019 – politisch übermotiviert und dem damaligen Zeitgeist folgend – ausgab. Niemand ahnte zu diesem Zeitpunkt, dass Corona-Pandemie, Ukraine- und Gaza-Konflikt, US-Zoll-Kapriolen und schwächelnde EU-Wirtschaft folgen werden. Unternehmen war auch noch nicht bewusst, welche Phalanx an Regelwerken den grünen Plänen den Weg ebnen sollte.
Grüne Regulatorik ufert aus
Dem zentralen Regelwerk, der EU-Taxonomie, folgten das EU-Klimagesetz, Pflichten zur Nachhaltigkeitsberichterstattung (CSRD) samt ausufernden Berichtsstandards (ESRS), das EU-Lieferkettengesetz (CSDDD), die EU-Entwaldungsverordnung (EUDR), die Richtlinie über Umweltaussagen (GCD), das Verbrenner-Aus ab 2035 und viele weitere Rechtsakte. Details, wie die Einstufung von Atomenergie als nachhaltig, sorgen in Politik und Wirtschaft für kontroverse Diskussionen. Österreich klagte dagegen, verlor jedoch Mitte September vor dem Europäischen Gerichtshof.
Aus Rückenwind wird Gegenwind
Angesichts der wirtschaftlichen Realität musste die EU-Kommission Ende 2024 erstmals Zugeständnisse machen. Die Anwendung der viel kritisierten EUDR wurde um ein Jahr auf Ende 2025 verschoben (mittlerweile erneut auf Ende 2026) und die CO2-Flottenemissionsziele der Autoindustrie wurden aufgeweicht. Fast im selben Atemzug gestand die Kommissionspräsidentin „damit Europa aufholen kann“ ein, dass die grüne Regulatorik zu viel, zu komplex und zu teuer ist. Sie kündigte Omnibus-Verordnungen an, mit denen zahlreiche Rechtsakte, wie CSRD und CSDDD, vereinfacht werden sollen. Um Zeit dafür zu schaffen, wurde deren Anwendung bereits um zwei Jahre bzw. ein Jahr verschoben.
Politik wendet sich ab

Je prekärer die wirtschaftliche Lage wird und je weniger grüne Parteien an Regierungen beteiligt sind, desto mehr wendet sich die Politik von der grünen Transformation ab. Mächtige Politiker stimmen in den Kanon der Wirtschaft ein und fordern beispielsweise die gänzliche Aufgabe der EU-Lieferketten-Richtlinie, der Richtlinie über Umweltaussagen und des bereits beschlossenen Verbrenner-Verbots ab 2035.
Österreich setzt sich für die gänzliche Abschaffung der EUDR ein. Wie viel Opportunismus und Lobby-Arbeit hinter diesen Bestrebungen stecken, verschließt sich der breiten Öffentlichkeit.
Situationselastizität nimmt zu
Im Zusammenhang mit der europäischen Verteidigungsfähigkeit keimt die Diskussion auf, ob Investitionen in die Rüstungsindustrie als nachhaltig gelten können. Dafür müssten die ESG-Kriterien schon sehr situationselastisch ausgelegt werden. Im September 2025 kündigte die Kommissionspräsidentin (zur Überraschung der Autoindustrie) an, Europa solle einen elektrischen Kleinwagen bauen. Beobachter orten darin die Einführung eines „Buchhaltungstricks“, den es 2020 und 2021 in ähnlicher Form bereits einmal gab. Mit der Doppel- oder gar Dreifachzählung solcher E-Kleinwagen könnten die Emissionsziele erneut schön gerechnet werden.
Schwenk zum Clean Industrial Deal
Sogar der EU-Kommission selbst scheint der Grüne Deal mittlerweile zu grün zu sein. Der neue gemeinsame EU-Fahrplan heißt daher Clean Industrial Deal. Bemerkenswert ist, dass dieser bereits in der Überschrift die Wettbewerbsfähigkeit vor die Dekarbonisierung stellt. Das Zieldatum der Dekarbonisierung 2050 bleibt aufrecht, wird in dem 30-seitigen Dokument allerdings nur mehr ein einziges Mal erwähnt. Es ist und wird eine enorm herausfordernde Aufgabe, sowohl die grüne Transformation als auch die europäische Wirtschaft nachhaltig zum Erfolg zu führen.
Dieser Beitrag ist erstmal im ESG-Special 2025 des Börsen-Kurier erschienen.